„Zur freundlichen Erinnerung an Johs Brahms“
Das Musikalbum der Hamburger Komponistin und Pianistin Louise Japha
Janine Droese
„Zur freundlichen Erinnerung“ – mit dieser kurzen Widmung unterschrieb Johannes Brahms im Oktober 1853 den eigenhändigen Eintrag seines damals noch ungedruckten Liedes „Liebe und Frühling I“ im Musikalbum Louise Japhas. Der Eintrag dokumentiert ein Wiedersehen, über das sich Brahms, wie er seinem Freund Joseph Joachim mitteilt, „wie ein Kind gefreut“ hat: Japha und Brahms kannten sich bereits aus ihrer Heimatstadt Hamburg und hatten sich nun in in Düsseldorf, wo Robert und Clara Schumann zu dieser Zeit lebten, wiedergetroffen. Beide waren dort Teil eines größeren musikalischen Freundeskreises, der sich im Album gewissermaßen materialisiert. Das Album gibt darüber hinaus Einblick in bisher unbekannte Netzwerke Japhas. Als einzigartige Sammlung musikalischer Autographe des 19. und frühen 20. Jahrhundert überliefert es 16 Kompositionen, von denen einige bis in die Gegenwart nicht gedruckt wurden. Zugleich ist es Zeugnis einer Praxis, die sich in Form von Poesiealben und Freundebüchern bis heute fortgesetzt hat, im 19. Jahrhundert aber wichtiger Bestandteil musikalischer Geselligkeit war.
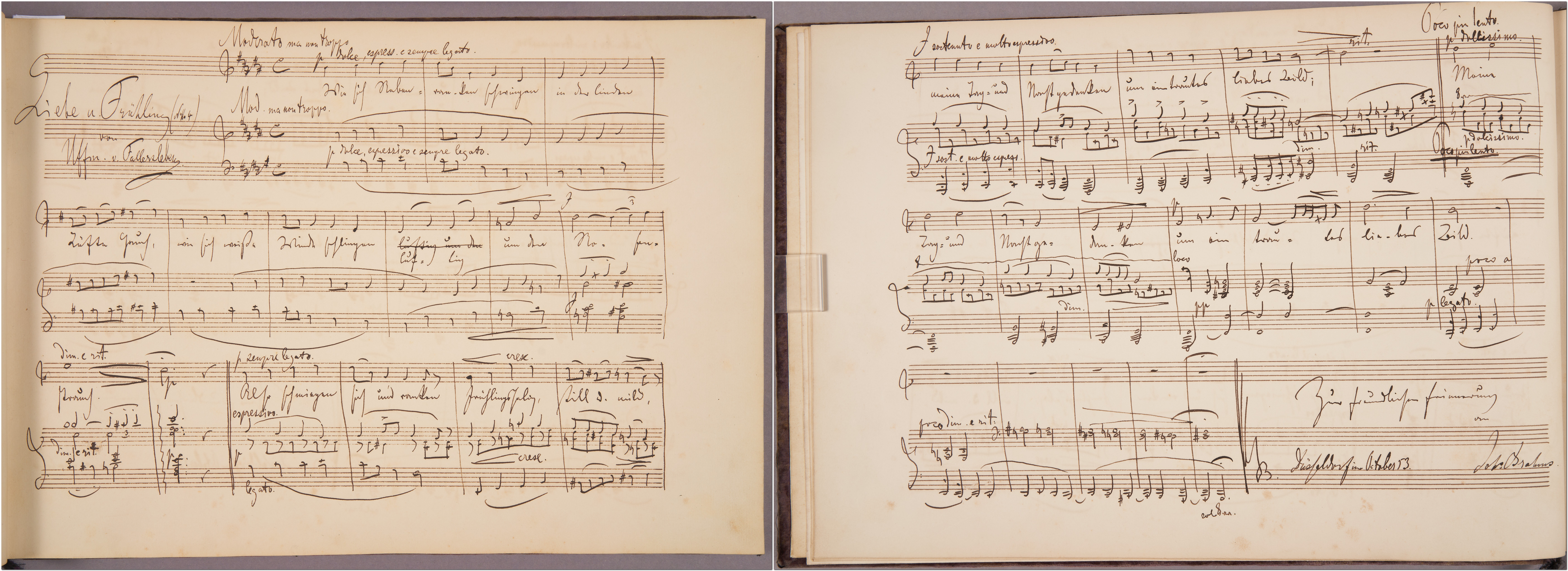
Musik in Alben zu sammeln war zu dieser Zeit ein äußerst beliebter Zeitvertreib. Musiker:innen, aber auch Musikliebhaber:innen, besaßen solche Alben und sammelten darin Einträge von Kolleg:innen, Bekannten, Freund:innen oder Mitgliedern ihrer Familie. Unter den Besitzer:innen solcher Alben finden sich so prominente Namen wie Felix Mendelssohn Bartholdy oder Robert und Clara Schumann. Während die meisten Albumhalter:innen in ihren Alben neben Musik auch Bild- und Texteinträge sammelten, gibt es eine kleine Gruppe an Musikalben im engeren Sinne, die aus-schließlich mit Notenpapier bestückt sind. Das Album Louise Japhas gehört zu dieser Gruppe der Musikalben.
Louise Japha erhielt das Album 1851, in der Zeit um ihren 25. Geburtstag, vermutlich als Geschenk, wie sich aus der dem Album vorangestellten Widmung auf fol. IIr schließen lässt. Das in violetten Samt gebundene, querformatige Buch misst 32,8 × 23,5 cm und umfasst 42 Blatt Notenpapier sowie drei lose eingelegte Blätter. Dabei haben die Blätter 1–21 jeweils neun Systeme pro Seite und sind so gestaltet, dass vor allem Lieder eingetragen werden können, da Platz für den Liedtext vorhanden ist (siehe bspw. Abb. 1). Die übrigen Blätter sind zehnzeilig rastriert, wobei immer zwei Systeme näher beieinanderstehen. Sie dienen damit vor allem der Eintragung von Klaviermusik (siehe bspw. Abb. 7). Der Titel „Album“ ist, wie auch ein Schmuckrand, in Gold auf den vorderen Buchdeckel aufgebracht (Abb. 2).

Einweihen durfte das neu erhaltene Buch der norwegische Komponist und Geigenvirtuose Ole Bull, der 1851 international auf Tournee war und im Frühjahr in Hamburg konzertierte. Bei dieser Gelegenheit sind sich Bull und Japha wohl begegnet, und Japha muss Bull darum gebeten haben, den ersten Eintrag für ihr Album zu verfassen. Bull notiert am 14. April 1851 ein Lied aus seiner Musik zum Schauspiel „Fjeldstuen“ (Die Berghütte) des norwegischen Dichters Henrik Wergeland, und versah es mit der Widmung „Zum freundlichen Andenken an Fräulein Louise Japha von ihr aufrichtiger Verehrer Ole Bull“ (Abb. 3). Der Text des im Volkston gehaltenen Liedes, das zu einem der größten kompositorischen Erfolge Bulls werden sollte, handelt von der Liebe zur Heimat, in der das lyrische Ich – im Schauspiel eine junge Frau, Sigrid – verharren will, bis ihr Geliebter zurückkehrt.
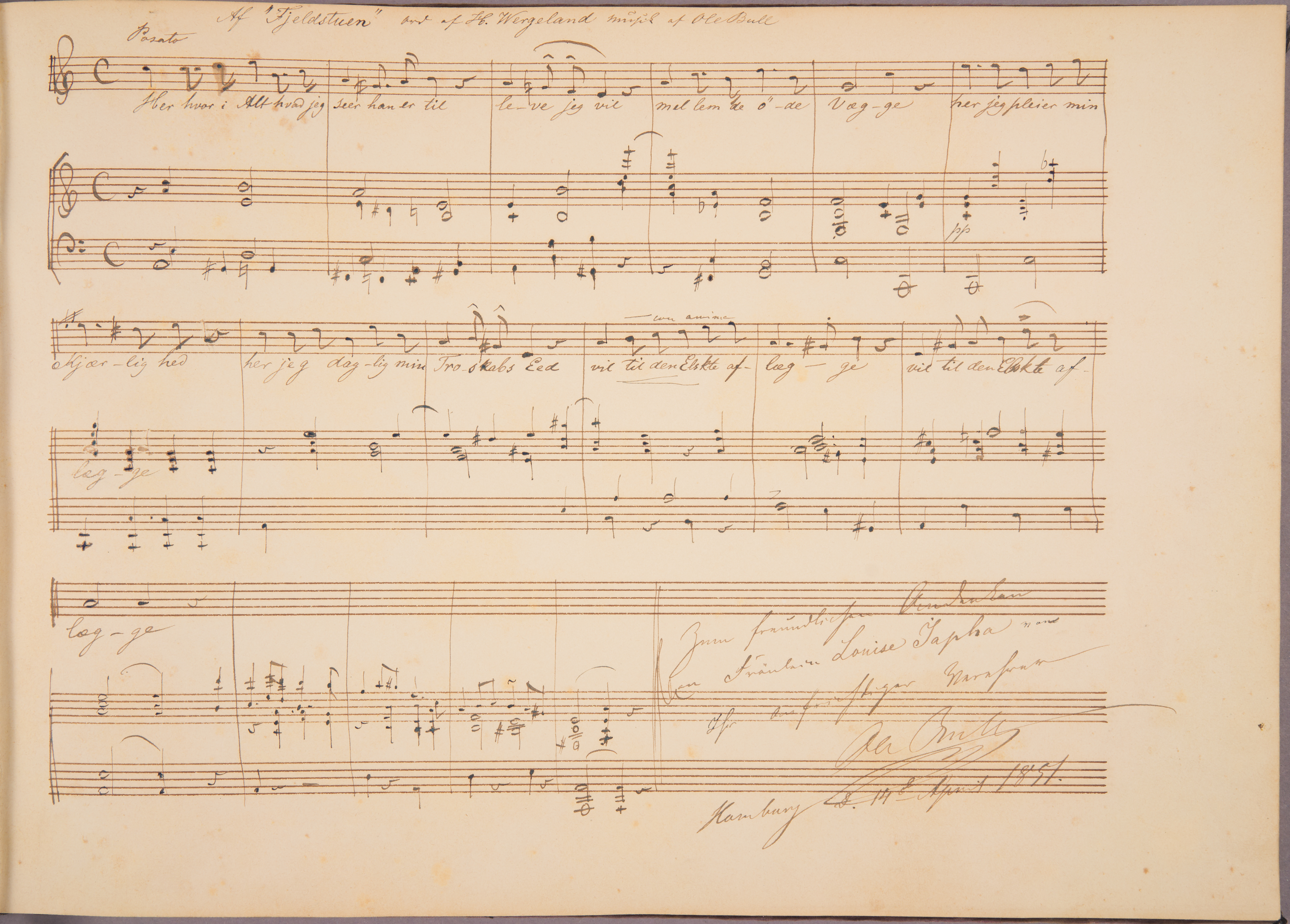
Nach diesem ersten Eintrag nutzte Japha das Album zunächst nicht wieder, nahm es aber offenbar im November 1852 mit nach Düsseldorf, wo im Oktober 1853 der nächste Eintrag erfolgte – das oben bereits gezeigte Lied von Brahms’ Hand. Zwei weitere Brahms-Autographe liegen dem Album als lose Blätter bei. Das erste, ein Albumblatt, ist neben Louise auch ihrer Schwester Minna Japha gewidmet – die Schwestern waren gemeinsam nach Düsseldorf gezogen, Minna studierte dort Malerei (Abb. 4). Das zweite ist kein Albumblatt, und war auch möglicherweise nicht dazu gedacht, aufbewahrt zu werden (Abb. 5). Brahms hat dort auf der Recto- und in der oberen Hälfte der Versoseite sein Lied „Liebe und Frühling II“ notiert, und das Notat – dessen Schlussschnörkel, wie häufiger bei Brahms, in ein „B“ ausläuft – mit dem Zusatz „Göttingen Juli 1853“ versehen. In der unteren Hälfte der Seite ist der Beginn eines Liedes notiert, das nur hier und nur fragmentarisch überliefert ist. Brahms betitelt es „Die Müllerin von Chamisso“. Die Noten dieses Liedes wurden nachträglich mit Bleistift ausgestrichen. Es liegt nahe, anzunehmen, dass Brahms das Blatt bei seinem Besuch bei Joseph Joachim in Göttingen im Sommer 1853 geschrieben hat und im Gepäck hatte, als er noch im selben Jahr nach Düsseldorf kam, wo er die Japha-Schwestern traf.
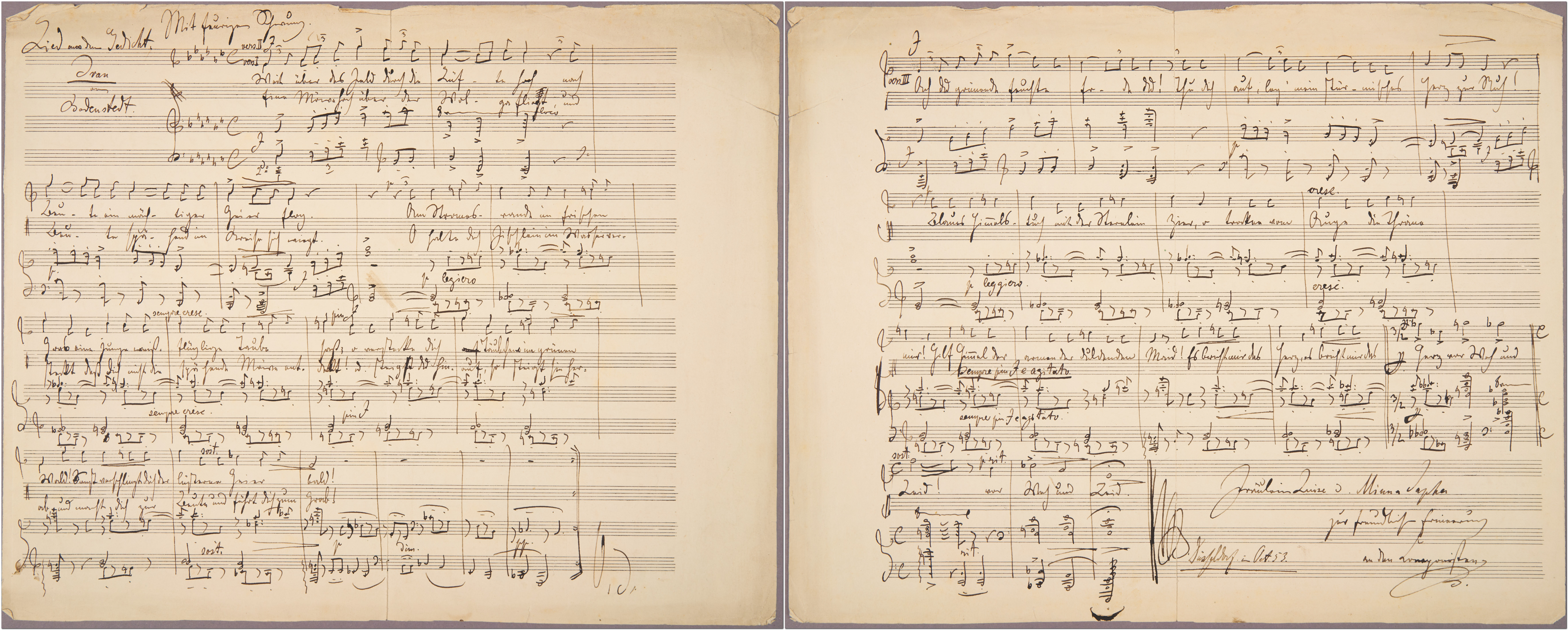
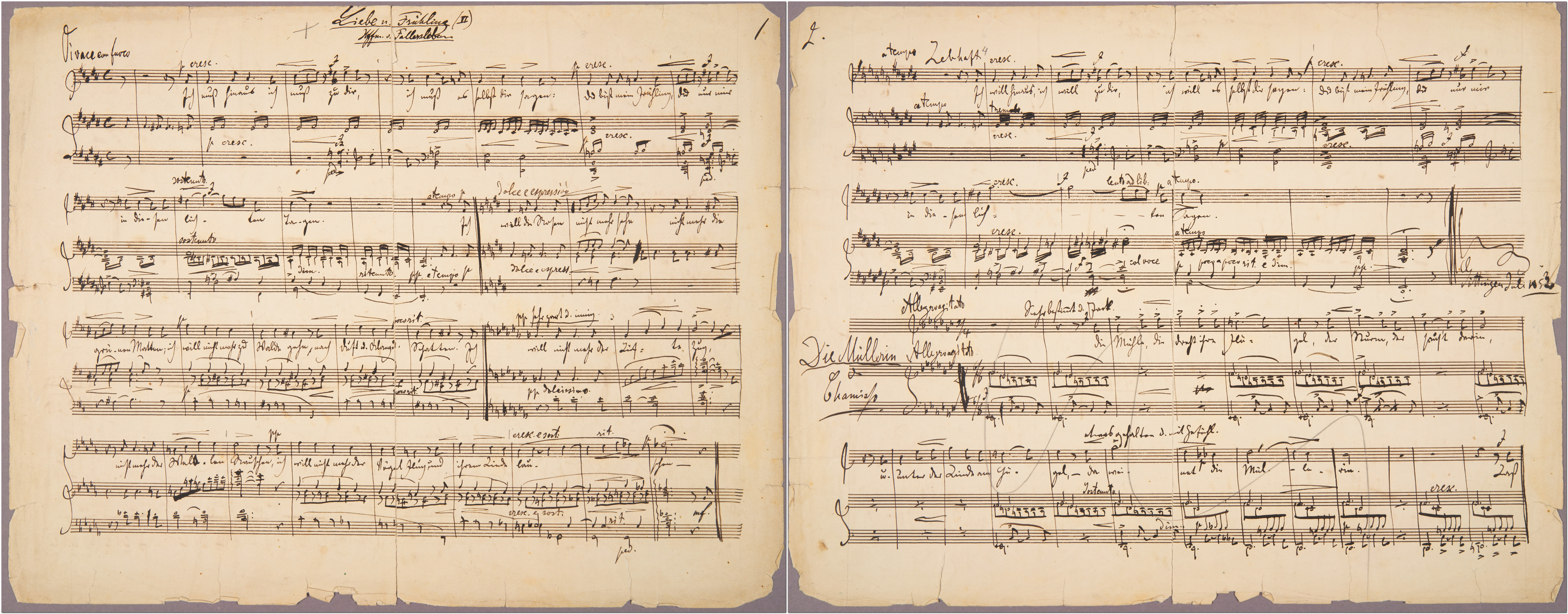
Bevor Japha Ende des Folgejahres Düsseldorf wieder verließ, sammelte sie noch drei weitere Einträge in ihrem Album – von den Brahms-Freunden Albert Dietrich und Julius Otto Grimm, die ebenfalls dem Kreis um die Schumanns angehörten, sowie von dem schwedischen Gesangspädagogen Oscar Axel Frithiof Lindhult, der in Düsseldorf als Lehrer der höheren Gesangskunst tätig war und zeitweise Marie und Elise Schumann unterrichtete. Lindhult trug am 7. Januar 1854 ein schwedisches Volkslied mit dem Titel „Wermlands-visa“ ein (Abb. 6), das bis heute sehr bekannt ist, beispielsweise sang Rufus Wainwright es beim Bankett zur Verleihung der Nobelpreise 2022.
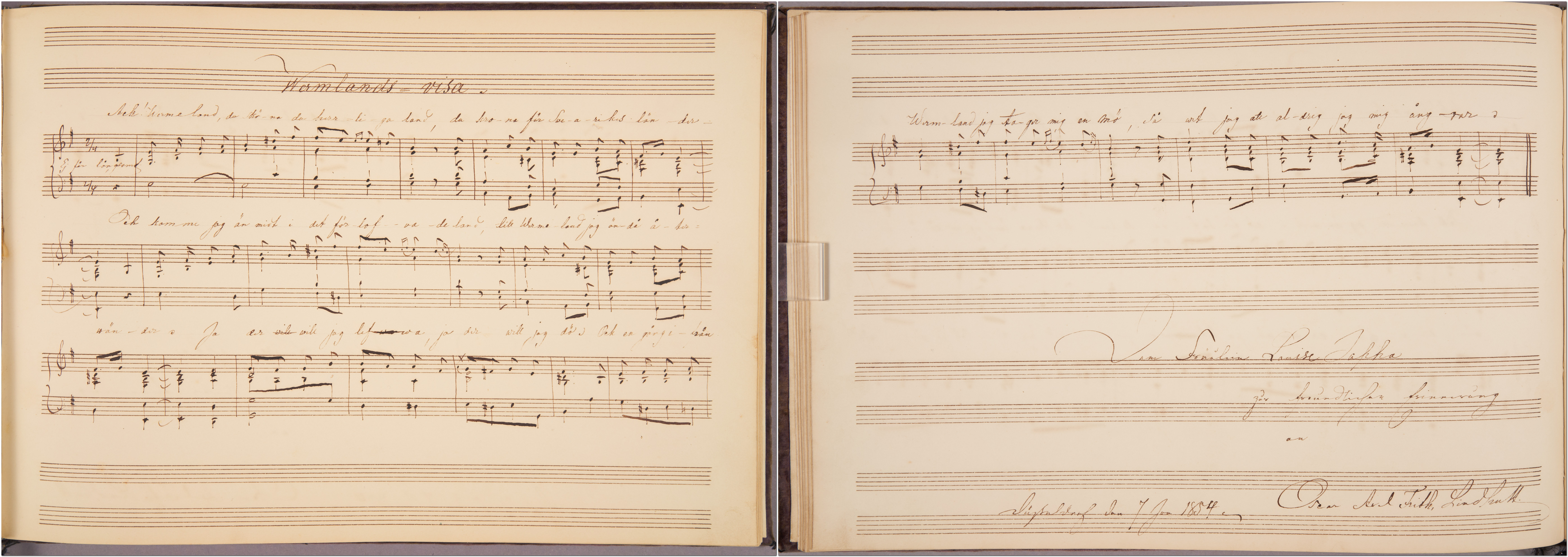
Dietrichs Eintrag, ein „Phantasiestück“, datiert auf den 23. Februar, ist das erste Klavierstück, das Eingang in das Album fand – angesichts der Tatsache, dass die Albumhalterin Pianistin war, ein überraschender Befund (Abb. 7). Er entstand in einer Zeit, die wegen des schlechten gesundheitlichen Zustands Robert Schumanns für alle Anwesenden in Düsseldorf sehr belastend war. Dietrich gehörte zum engen Freundeskreis Robert Schumanns, der ihn in seinem bekannten Aufsatz „Neue Bahnen“ unter die „hochaufstrebenden Künstler der jüngsten Zeit“ rechnet. Seine Komposition für das Album ist meiner Kenntnis nach nur hier überliefert.
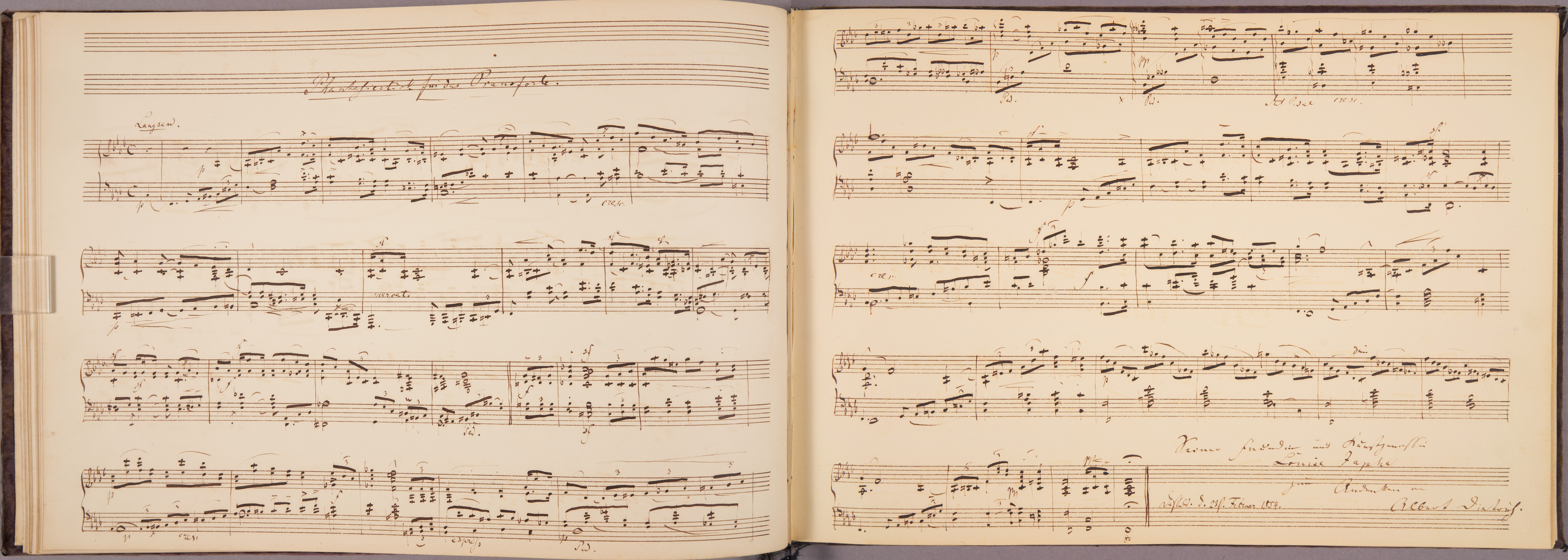
Grimm notierte ein Lied, „Unruhe“ betitelt, das ein Jahr später als No. 2 seiner der Leipziger Sängerin und Salonnière Livia Frege gewidmeten Sechs Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte op. 7 bei Kistner in Leipzig gedruckt wurde.
Im November 1854 verließ Japha Düsseldorf, von 1855 bis 1857 konzertierte sie regelmäßig in Berlin. Einträge in ihrem Album dokumentieren den Aufenthalt in Berlin noch bis ins Frühjahr 1858, weisen aber auch auf regelmäßige Aufenthalte in ihrer Heimatstadt Hamburg hin. Insgesamt sechs Kompositionen konnte sie zwischen 1855 und 1858 ihrem Album hinzufügen, darunter zwei kurze Stücke für Klavier, notiert von der Berliner Pianistin und Komponistin Clara von Gossler 1855 in Berlin und von dem aus Stendal stammenden Komponisten und Dirigenten Julius Schaeffer 1857 in Hamburg. Zwischen Januar und April kamen zudem zwei Lieder und ein Duett hinzu: am Neujahrstag 1858, Japha war wohl auf Heimaturlaub, notierte der wie Japha in Hamburg geborene Pianist und Komponist Wilhelm Goldner ein Lied mit dem Titel „Das Grab“, im Februar folgt der Eintrag eines Duetts des Berliner Komponisten und Musikkritikers Richard Wüerst (Abb. 8), und im April der Eintrag eines Liedes auf einen Text aus den Hebräischen Melodien Lord Byrons durch die Sängerin und Komponistin Auguste Leo (geb. Loewe), die seit 1838 Mitglied der Berliner Singakademie war und dort bis 1847 regelmäßig Solopartien übernahm (Abb. 9).
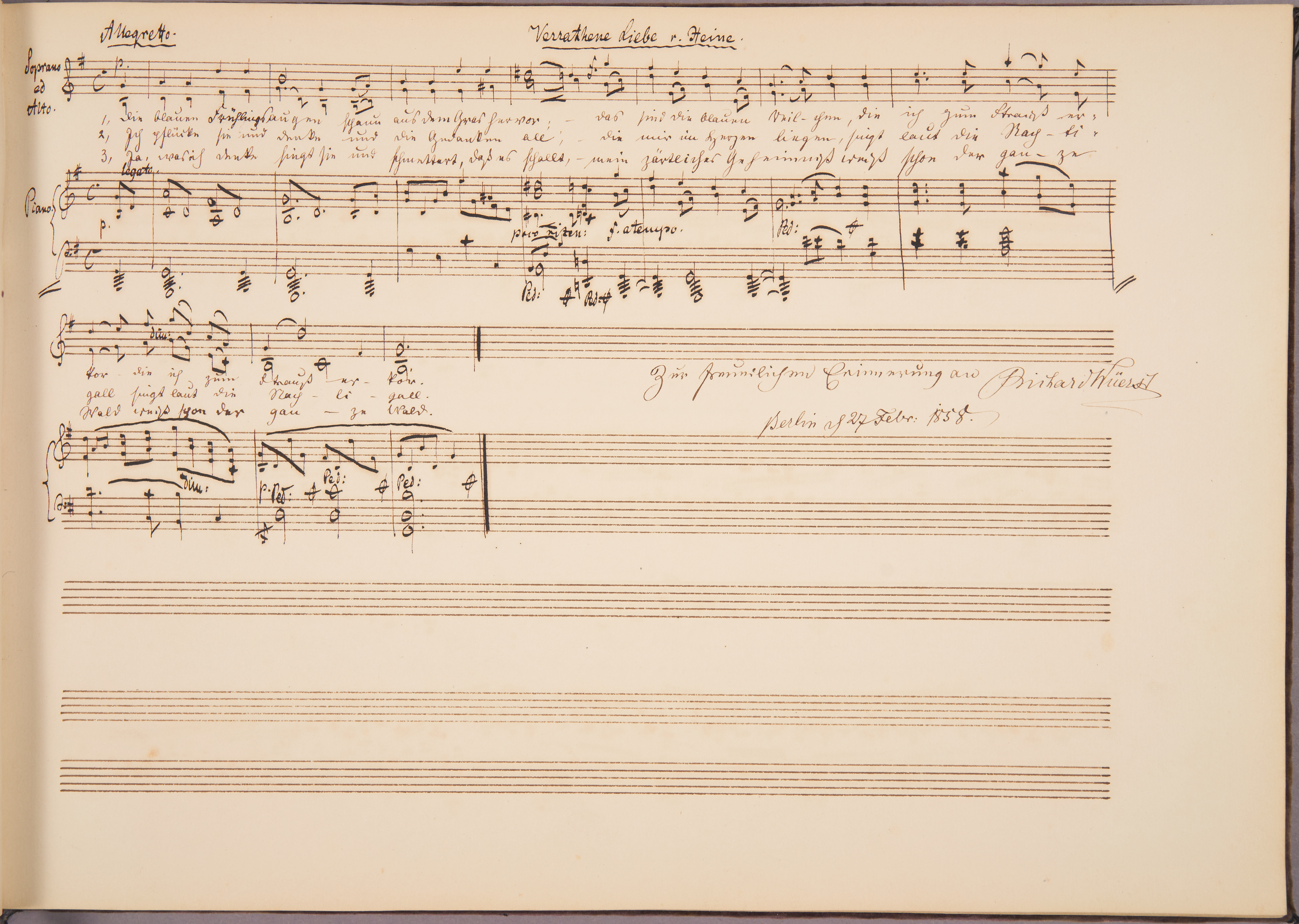
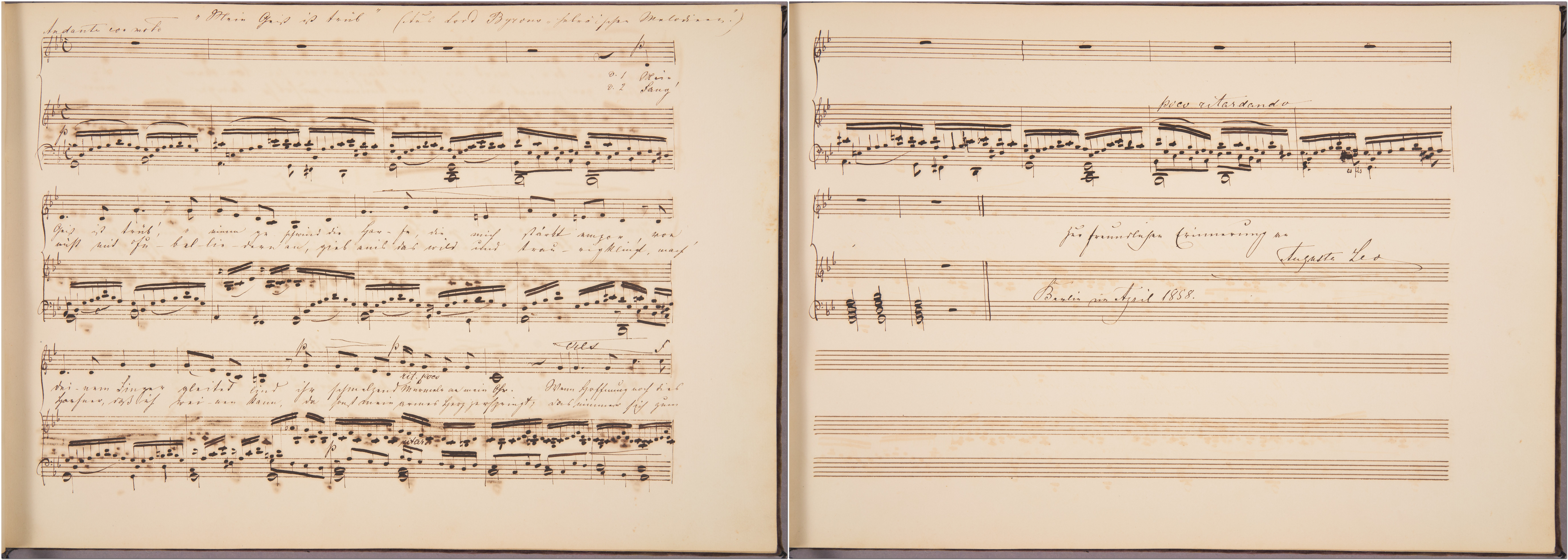
Am 15. Juli 1858 heiratete Louise Japha den Geiger, Komponisten und Musikschriftsteller Friedrich Wilhelm Langhans, mit dem sie drei Söhne bekommen sollte. Mit ihrer Hochzeit scheint sie ihr Album zur Seite gelegt zu haben – daher verwende ich hier auch durchgängig ihren Mädchennamen Japha. Damit sind im Album keine Spuren der vermutlich erfolgreichsten Jahre ihrer Karriere vorhanden: das Ehepaar Langhans machte sich vor allem in den 1860er Jahren mit der Aufführung deutscher Kammermusik in Paris einen Namen. Dass Frauen ihre Alben nach der Hochzeit nicht mehr weiterführten, lässt sich nicht nur bei Japha beobachten, sondern scheint üblich gewesen zu sein, Vergleichbares findet sich bspw. auch bei Fanny Mendelssohn Bartholdy. Interessant ist allerdings der letzte Eintrag vor ihrer Hochzeit, am 10. Juli 1858 notiert von dem Geiger und Komponisten Carl Witting, der 1860 Louises Schwester Minna heiraten sollte, die er über Louise Japha kennengelernt hatte. Witting schrieb in das Album ein Stück für Violine und Klavier, das er mit der Widmung „Der talentvollen Kunstgenossin Louise Japha zur freundschaftlichen Erinnerung an Carl Witting Bruder in Apollo.“ versah (Abb. 10). Dabei handelt es sich um die einzige Komposition für Violine in dem Album. Das mag einerseits an Wittings eigener Profession als Geiger liegen, die Auswahl könnte aber auch im Hinblick auf die zukünftige Ehe Japhas mit dem Geiger Friedrich Wilhelm Langhans getroffen worden sein.
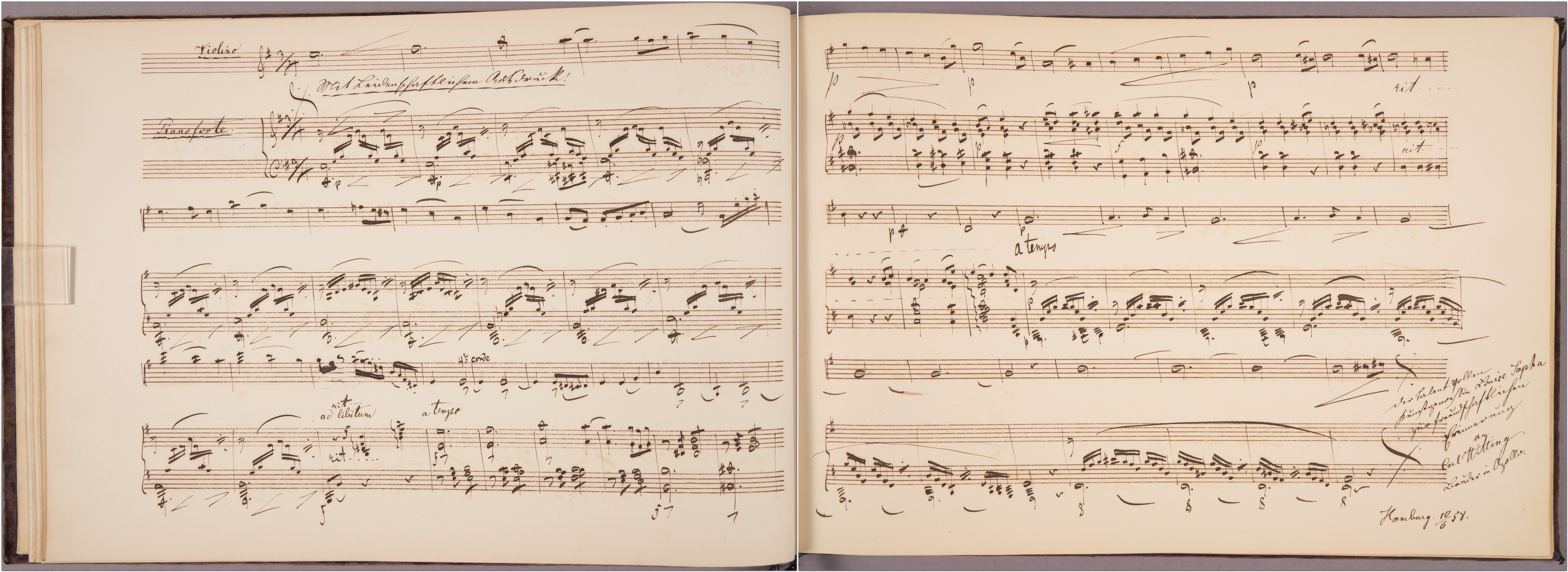
Durch Carl Witting lässt sich noch mehr über die Albumhalterin Louise Japha, verheiratete Langhans, erfahren. Im Besitz der Nachfahren Japhas findet sich neben dem Album auch ein Band mit Lebenserinnerungen Carl Wittings, die bisher nicht öffentlich bekannt waren und daher auch nicht wissenschaftlich ausgewertet wurden. Ein Abschnitt darin gibt Einblick in ein Treffen Wittings mit Louise Japha in Hamburg im Jahr 1858, also in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu seinem Eintrag ins Album (für die Transkription danke ich Dorothea Grube):
Eines Tages führte mich mein Weg an der Alster entlang, da bemerkte ich zu meiner größten Freude auf der andern Seite des Weges L. Japha, deren Bekanntschaft ich in Berlin gemacht hatte. Ich eilte hinüber, um sie zu begrüßen, aber sie bog in eine Seitenstraße ehe ich sie erreichen konnte […]. Am selben Abend war die Aufführung des Geigers Haffner, wozu ich eine Einladung erhalten hatte [...]. Zur bestimmten Zeit hatte ich meinen Platz eingenommen, da klopft mir Jemand auf die Schulter, ich wende mich um u. bemerke d Japha die hinter mir ihren Platz hatte. Nach der Aufführung gingen wir zusammen fort u. ich war überrascht zu vernehmen, daß sie Hamburgerin sei u. bei ihren Eltern jetzt zum Besuche verweile. Auch wünschte sie dringend mich sofort den Ihrigen vorstellen zu können […]. Meine Einwendung, daß es für ihre Eltern wohl etwas zu spät sein dürfte einen so fremden Besuch zu erhalten, nützte nichts ich mußte mit ihr gehen. Gegen 10 Uhr waren wir im Hause angekommen u. sie stellte mich da als ihren Kollegen aus Berlin vor.
Die Eltern hiessen mich herzlich willkommen, und das Fr. rief gleich der Köchin zu noch ein Gedeck herbei zu bringen denn ihr Abendbrot stand bereit, die jüngere Schwester Meta lief sogleich danach, während eine andere Schwester, Minna, am Arme ihrer Mutter gelehnt, mich mit ihren gr. schwarzen Augen fast melancholisch ansah. Ihre Gesichtsfarbe hatte eine vornehme Blässe u. durch ihr ruhiges, sinnendes Wesen schien sie das gerade Gegenteil zu sein von ihrer lebendigen u. zu witzelnden Bemerkungen geneigten Schwester Louise, meiner Berliner Kollegin. Hier muß ich bemerken, daß die Louise als bedeutende Klaviervirtuosin u. als vorzüglich theoretisch gebildete Musikerin sich allgemeiner Wertschätzung erfreute. […] Von nun an war ich oft zu Gast in dieser geselligen Familie.
Die Ehe der Langhans’ sollte nicht von langem Bestand sein – bereits seit den frühen 1870er Jahren lebten Louise und Friedrich Wilhelm Langhans dauerhaft getrennt, vor 1890 folgte offiziell die Scheidung. Louise ließ sich nach einem Aufenthalt in Südfrankreich 1875 in Wiesbaden nieder, wo sie bis zu ihrem Lebensende 1910 lebte, komponierte, Konzerte gab und als Klavierlehrerin, vor allem für fortgeschrittene Schülerinnen, beliebt war. Wegen eines fortschreitenden Gehörleidens zog sie sich spätestens in den 1890er Jahren aus der Öffentlichkeit zurück, nur ein enger Kreis an Freunden hatte Zugang zu ihrem Haus und damit die Gelegenheit, ihrem Klavierspiel zu lauschen. Dazu zählt auch der Komponist, Musikjournalist und Musiklehrer Edmund Uhl, der ebenfalls in Wiesbaden lebte. Der eine ganze Generation jüngere Uhl scheint eine enge Beziehung zu Japha gehabt zu haben. 1906 widmete er ihr zum achtzigsten Geburtstag einen zweiseitigen Artikel in der Neuen Zeitschrift für Musik, in dessen letzten Absatz er festhält:
Mögen diese Zeilen unserer raschlebigen, nervös vorwärts hastenden Zeit den Namen der ehrwürdigen Kunstveteranin ins Gedächtnis rufen, die […] sich bei aller Treue gegen ihren Lieblingsmeister R. Schumann volle Fühlung mit den Strömungen unserer modernen Musik zu bewahren gewusst hat.
Für diese „modernen Strömungen“ öffnete Japha in den letzten Lebensjahren nochmals ihr Album. Im Juli 1904 schrieb ihr der damals 24-jährige Komponist und Dirigent Hermann Noetzel, der in Wiesbaden geboren und zu dem Zeitpunkt vermutlich auf Heimaturlaub war, ein kurzes Klavierstück ins Album, das deutlich impressionistische Züge trägt (Abb. 11).
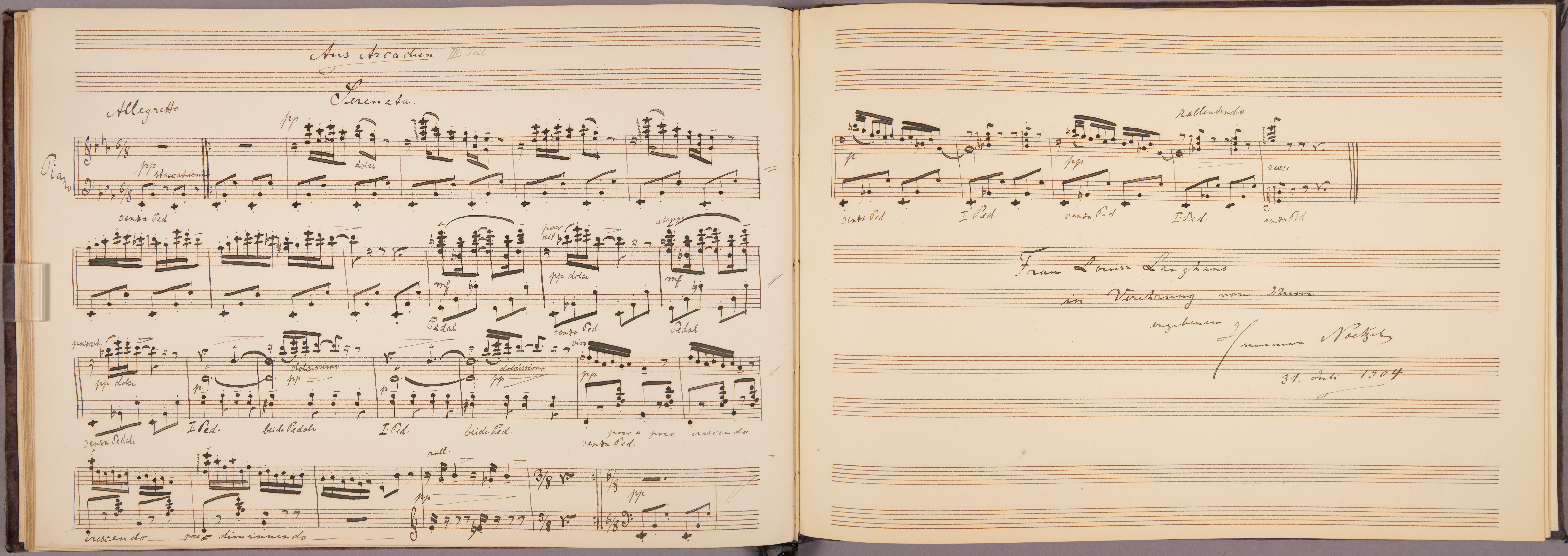
Aber auch der oben bereits erwähnte Edmund Uhl durfte sich in das Album eintragen (Abb. 12). Er versah seinen Beitrag, der auf den 23. November 1903 datiert ist, mit der Widmung „Seiner verehrten mütterlichen Freundin zur freundlichen Erinnerung.“ Notiert ist die Vertonung eines Gedichts der österreichischen Lyrikerin und Journalistin Jenny Schnabl, die in Wien das Konservatorium besucht hatte und 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt ums Leben kam. Es trägt den Titel „Einst…“, der Text lautet folgendermaßen:
Über meinem Leben lag
Einst ein Hauch wie Sonnenduft,
Wie er an Frühsommertagen
Taut in blauer Morgenluft.Über meinem Leben liegt
jetzt ein Dämmerhauch, so still,
Wie an kurzen Wintertagen,
Wenn es Abend, Abend werden will.
Diese melancholischen Verse können unschwer als Bild für das Alter, die durch das Gehörleiden bedingte Zurückgezogenheit Louise Japhas und die Erinnerung an frühere, schönere Zeiten gesehen werden. Das Bild des nahenden Abends mag auf die Endlichkeit des Lebens verweisen – Uhl reagiert auf dieses Sprachbild musikalisch mit zunehmender Verlangsamung und einem sich nach und nach in tieferen Tonhöhenbereichen verlierenden Satz.
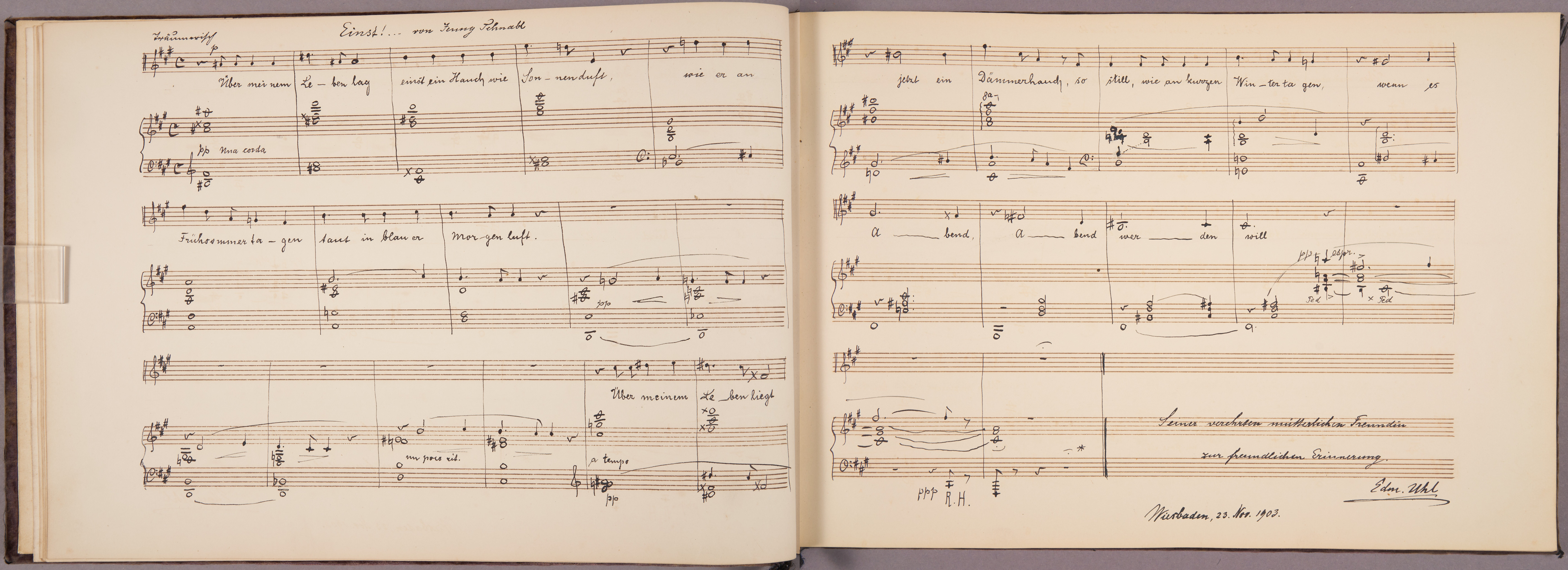
Damit deckt das Album, wenngleich mit einer großen Unterbrechung, das Leben Louise Japhas, verh. Langhans, von ihrer Zeit als junge, unverheiratete Frau, die noch bei ihren Eltern lebte, bis zu ihrem 79. Lebensjahr ab. Die Eintragungen erfolgten dabei an nur vier unterschiedlichen Orten: Ihrem Geburtsort Hamburg, Düsseldorf, Berlin und Wiesbaden. Dabei scheint Japha sowohl eine strenge Auswahl der Einträger:innen getroffen als auch ihre Erwartungen an die Einträge deutlich gemacht zu haben – dass sich ausschließlich vollständige, spielbare Kompositionen im Album finden, die zum größten Teil zum Zeitpunkt des Eintrags noch nicht publiziert waren, kann durchaus als bemerkenswert gelten. Erstaunlich erscheint mir, dass im Album keine Einträge von Robert und Clara Schumann zu finden sind. Dass Robert Schumann Louise Japha als Komponistin schätzte geht aus einem 1854 verfassten Brief an den österreichischen Dichter Hermann Rollett hervor, in dem er anmerkt, Louise Japha wisse „gute töne zu guten Liedern“ – gemeint sind hier Gedichte – zu finden. Da mehrere Blattstümpfe im Album auf später entfernte Seiten hinweisen, könnten allerdings auch Seiten mit Einträgen der beiden Schumanns nachträglich aus dem Album entfernt worden sein. In dieser Hinsicht würde dieses besondere Manuskript einer gut vernetzten und offensichtlich von vielen Kolleg:innen hochgeschätzten Musikerin – die abschließende Abb. 13 zeigt sie in fortgeschrittenem Alter in einem von nur zwei überlieferten Portraits – den Normen der Manuskriptgattung folgen. Insgesamt ist vor allem ihre Düsseldorfer Zeit gut dokumentiert, wobei unter den Einträger:innen eindeutig Johannes Brahms eine Sonderstellung einnimmt, überliefert das Album doch gleich drei Autographe dieses Komponisten. Ihm wird diese Kumulation von Einträgen möglicherweise nicht bewusst gewesen sein, erfolgte doch nur einer der Einträge direkt ins Album. Dem heutigen Betrachter hingegen kann die Sammlung damit einen Eindruck davon vermitteln, wie wichtig für Japha der Austausch mit Brahms gerade in den 1850er Jahren gewesen sein mag.
Digitalisiertes Manuskript
Music Album of Louise Langhans (née Japha), Private Collection, Freiburg, 1851–1904 <http://doi.org/10.25592/uhhfdm.10770>
Übersicht über die gesammelten Albumblätter
Die Einträge im Musikalbum von Louise Langhans, geb. Japha, <http://doi.org/10.25592/uhhfdm.14829>
Ausgewählte Literatur
Babbe, Annkatrin (2011), „Langhans, Louise, Luise (Hermine), geb. Japha“, in Europäische Instrumentalistinnen des 18. und 19. Jahrhunderts, hrsg. vom Sophie-Drinker-Institut für musikwissenschaftliche Frauen- und Geschlechterforschung, <https://www.sophie-frinker-institut.de/langhans-louise> (letzter Abruf 26. August 2024).
Beer, Axel (2023), „Hermann Noetzel“, in Musik und Musiker am Mittelrhein 2, hg. von Axel Beer, <https://mmm2.mugemir.de/doku.php?id=noetzel> (letzter Abruf 26. August 2024).
Beer, Axel und Gudula Schütz (2023), „Edmund Uhl“, in Musik und Musiker am Mittelrhein 2, hg. von Axel Beer, <https://mmm2.mugemir.de/doku.php?id=uhl> (letzter Abruf 26. August 2024).
Droese, Janine (2023), „‚J’aime bonne compagnie‘ – Fragile Cohesion, Communicative Processes and the Stratigraphy of Nineteenth-century Music-related Albums“, manuscript cultures, 20, 51–70, <https://www.csmc.uni-hamburg.de/publications/mc/files/articles/mc20-droese.pdf> (letzter Abruf 26. August 2024).
Droese, Janine und Janina Karolewski (Hg., 2024), Manuscript Albums and their Cultural Contexts: Collectors, Objects, and Practices, (Studies in Manuscript Cultures, 34); Berlin: De Gruyter 2024, <https://doi.org/10.1515/9783111321462> (letzter Abruf 26. August 2024).
Falling, Carol (2022), Dokumentarfilm Louise Langhans-Japha (1826–1910) <https://www.youtube.com/watch?c=B0LIrlB2uBl> (Wiesbadener Komponistinnen: Schicksale und Erfahrungen, 2) (letzter Abruf 26.August 2024).
Falling, Carol (2022), „Brahms’s Childhood Friend Louise Langhans-Japha: New Discoveries“, The American Brahms Society Newsletter XL/2, 1–6.
Kalbeck, Max (1904–1914), Johannes Brahms, 4 Bde., unveränderter Nachdruck der Ausgabe letzter Hand, Tutzing: Schneider 1976.
Schütz, Gudula (2024), „Louise Langhans-Japha“, in Musik und Musiker am Mittelrhein 2, hg. von Axel Beer, <https://mmm2.mugemir.de/doku.php?id=langhans> (letzer Abruf 26. August 2024).
Teske-Spellerberg, Ulrike (1966), „‚Ich habs gewagt‘“. Louise Langhans-Japha. Eine vergessene Komponistin der Romantik“, in Festschrift für Winfried Kirsch zum 65. Geburtstag, hg. von Peter Ackermann, Ulrike Kienzle und Adolph Nowak, Tutzing: Schneider. 359–375.
Beschreibung
Standort: Privatbesitz, Freiburg im Breisgau
Größe und Umfang: 32,8 × 23,5 cm (quer); III, 42, II Blatt plus drei Blatt als Beilage
Material: Tinte auf Papier; violetter Samteinband mit Goldprägung, dreiseitiger Goldschnitt; Gedruckte Grafik als Titelblatt; Vorsatz Moiré-Papier
Laufzeit: 1851–1904
Eintragsorte: Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Wiesbaden
Urheberrechtshinweise
Copyright für alle Abbildungen: Creative Commons Attribution 4.0 International
Danksagung
Mein herzlicher Dank geht an die Nachfahrinnen Louise Japhas, die die Digitalisierung und wissenschaftliche Auswertung des Albums ermöglicht und mir weiteres Material zur Verfügung gestellt haben. Eva Baumann und Dorothea Grube danke ich zudem für die gemeinsame Organisation eines Gesprächskonzertes zu diesem Album, das am 14. Oktober 2023 an der Musikhochschule Freiburg im Breisgau und am 15. Oktober 2023 in der evangelischen Stadtkirche Emmendingen stattfand. Der vorliegende Text geht zurück auf diese Veranstaltung. Danken möchte ich auch Jörn Bartels und Michael Baumann, die sich ebenfalls an der Organisation beteiligt und darüber hinaus als Pianisten bei dem Konzert mitgewirkt haben, ebenso wie an Siri Thornhill und Pascale Jonczyk (Gesang) sowie Antonio Pellegrino (Violine). Allen Musiker:innen danke ich für die Erlaubnis, das Konzert aufzunehmen und Ausschnitte daraus zu publizieren.
Zitierhinweis
Janine Droese, “Zur freundlichen Erinnerung an Johs Brahms”: Das Musikalbum der Hamburger Komponistin und Pianistin Louise Japha. In Leah Mascia, Thies Staack (eds): Artefact of the Month No. 32, CSMC, Hamburg.
